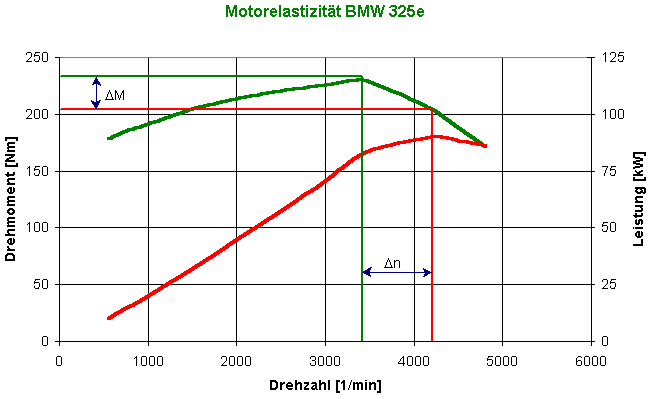
Der 325e wird oft als elastisches Fahrzeug bezeichnet. Grund dafür ist das Fahrverhalten des Wagens. Er schiebt schon bei niedrigsten Drehzahlen beachtlich an.
Nun, per Definition gibt es verschiedene Elastizitäten: Die des Motors und die des Fahrzeugs.
Die Elastizität des Motors ist die Fähigkeit, bei Abgabe der maximalen Leistung ein höheres Drehmoment abzugeben unter Abfall der Drehzahl bis zum maximalen Drehmoment. Ein Motor ist desto elastischer, je mehr Drehmoment er aufzubauen vermag und je mehr Drehzahlabfall dabei möglich ist.
Wenn man sich die Drehmoment- und Leistungskurve des 325e anschaut,
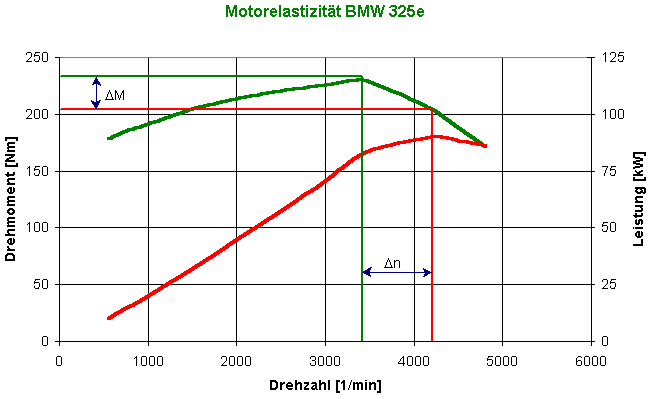
so erkennt man, daß zwischen der Drehzahl, bei der das höchste Drehmoment erreicht wird (3250/min) und jener, bei der die höchste Leistung anliegt (4250/min) nur 1000/min Unterschied sind. Ebenso fällt der Drehmomentunterschied mit 28Nm nicht gerade groß aus.
Zum Vergleich der 324td:
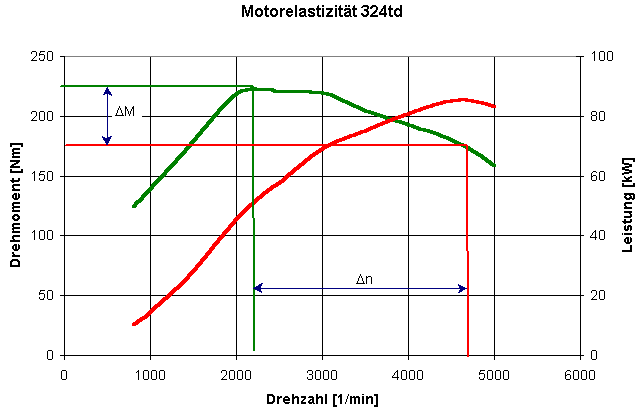
Drehzahldifferenz hier: 2400/min, Momentenanstieg: 53Nm.
Die Motorelastizität ist definiert als:
E = (n_nenn / n_Mmax) * (M_max / M_nenn)
Für den Eta-Motor erhält man durch einsetzen:
E = (4250min-1 / 3250min-1) * (230Nm / 202Nm) = 1,308 * 1,139 = 1,489
Der Turbodiesel kommt auf folgende Werte:
E = (4800min-1 / 2400min-1) * (222Nm / 169Nm) = 2,000 * 1,314 = 2,627
Der 324td ist also per Definition der deutlich elastischer Motor. Im normalen Straßenverkehr spürt man diesen Unterschied am Berg. Der td kann länger im hohen Gang gefahren werden, verliert aber auch mehr Geschwindigkeit durch die niedrige Drehzahl, bei der das höchste Drehmoment anliegt.
Sie ist definiert als die Zeit, um das Fahrzeug im zweithöchsten Gang von 60 auf 100 km/h zu beschleunigen (in der Ebene mit "Normzuladung" und anderen Randbedingungen) und als Zeit, um das Fahrzeug (unter den gleichen Bedingungen wie zuvor) im höchsten Gang von 80 auf 120 km/h zu beschleunigen.
Zum Vergleich die Werte vom Eta und vom td:
| BMW 325e | BMW 324td | |
| 60 - 100 km/h (4.Gg.) | 10,4 s | 10,4 s |
| 80 - 120 km/h (5. Gg.) | 15,1 s | 14,8 s |
| 40 - 180 km/h (5. Gg.) | 65,3 s | 90,6 s |
Der td ist also im 5. Gang dem Eta in dieser Disziplin überlegen. Dies ist Fakt. Trotzdem fühlt sich der Eta "elastischer" an. Das liegt daran, daß der Eta bei jeder Drehzahl kräftig zieht, wenn man das Gaspedal niederdrückt. Beim td ist zunächst ein kurzer Augenblick des Wartens angesagt, bis der Turbolader den Ladedruck aufgebaut hat, selbst dann geht es nur im Bereich zwischen 2000 und 3000/min ein klein wenig schneller voran als im Eta. Und das liegt nur an der kürzeren Achse, ansonsten käme ein Patt dabei heraus. In allen anderen Drehzahlbereichen beschleunigt der Eta besser, weil er mehr Drehmoment zur Verfügung hat.
Um das einmal zu verdeutlichen ist es nützlich, den Beschleunigungbereich nach unten (40 km/h) und oben (180 km/h) zu erweitern. Wie zu erkennen ist, behält hier der Eta die Oberhand, was aus den Drehmomentkurven heraus logisch ist. Man kann also sagen, daß der td gerade mal in den Standarddisziplinen mithalten kann, aber im Alltag das unterlegene Automobil ist.
So kann also das Datenblatt eines Wagens sehr gut ausschauen (z.B. bei den modernen, direkt einspritzenden Turbodiesel-Motoren) und trotzdem hat man auf der Probefahrt das Gefühl, der Wagen beschleunigt schlechter als ein anderer, der vielleicht dem Datenblatt nach unterlegen ist. Und es ist sogar so. Denn Fahrzeuge werden oft auf Standard-Meßwerte getrimmt, um dort zu brillieren. Der Eta wurde das nicht, und das kann man jederzeit eindrucksvoll "erfahren".
Anschauen kann man sich das natürlich auch auf Grafiken, die man Zugkraftdiagramm nennt. Es ist dort die Zugkraft am Rad (jene Kraft, die das Fahrzeug direkt beschleunigt) über der Geschwindigkeit aufgetragen.
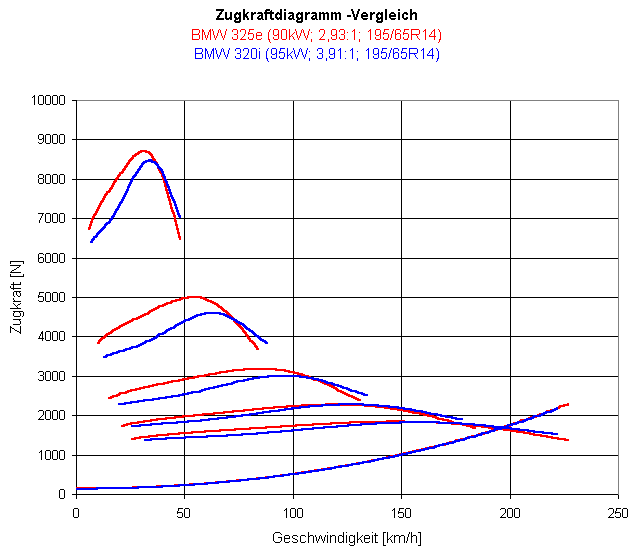
Man sieht hier, daß der Drehmomentmangel des 320i nicht so stark in Erscheinung tritt, wie im Vergleich der Drehmomentkurven. Das liegt daran, daß der 320i wesentlich kürzer untersetzt ist, als der Eta. Trotzdem wiegt das den Drehmomentunterschied nur zum Teil auf, nämlich immer nur im obersten Drehzahlbereich, wo der 320i seine 5 kW Mehrleistung ausspielt. Es ist weiterhin erkennbar, dass im Eta wesentlich seltener zurückgeschaltet werden muß, da immer ein großer Kraftvorteil gegenüber dem 320i im unteren und mittleren Drehzahlbereich vorhanden ist. Fazit: um mit dem 320i genauso schnell unterwegs zu sein, muß häufiger geschaltet werden, das treibt die Drehzahlen und damit den Verbrauch nach oben. Das ist also mit "mehr Kraft bei gleichzeitiger Sparsamkeit" gemeint.
Im Vergleich zum 324td sieht das Diagramm so aus:
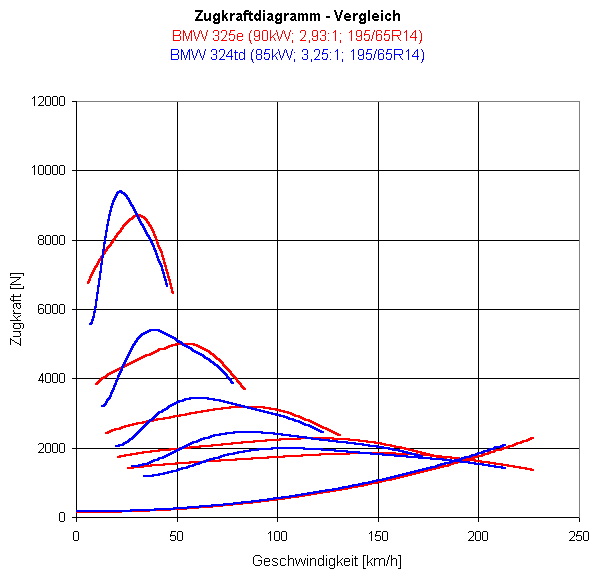
Durch die kürzere Achse erweitert der td seinen Drehmomentvorteil um 2000/min herum aus und ist deshalb in den Elastizitätsfahrten so überlegen. Doch unter 2000/min geschieht im Gegendatz zum Eta nicht viel, so daß man auch hier auf höhere Drehzahlen als beim Eta angewiesen ist. Um vergleichbare Fahrleistungen wie mit dem Eta zu erzielen der bei 2000/min geschaltet wird, muß man beim td bei ca. 3000/min schalten, um nicht in den Drehmomentkeller unterhalb von 2000/min zu fallen und den Anschluß zu verlieren. Das hat zum Resultat, daß der td de facto genauso viel verbraucht, wie der Eta (nur Dieselkraftstoff statt Normalbenzin natürlich), wenn sie gleich zügig bewegt werden.
Um die Betrachtungen zu komplettieren scheint ein Blick auf den Vergleich 325e - 325i sinnvoll.
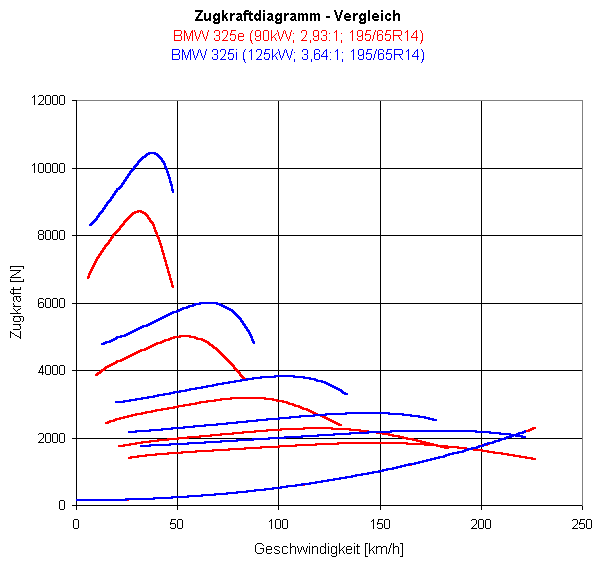
Durch die wesentlich kürzere Achsuntersetzung kann der i sein Drehmoment wesentlich besser in Vortrieb umsetzen, als der Eta. Die Schaltpunkte liegen etwa bei gleichen Geschwindigkeiten, jedoch dreht der Eta dort 4800/min und der i 6200/min. Es steht also wesentlich mehr Leistung zur Verfügung. Der i hängt den Eta demnach immer um Längen ab. 50 PS Differenzleistung müssen sich ja irgendwie bemerkbar machen.
20.10.2001, Ben